Eine kleine Geschichte über den Werdegang von Thomas S. Kuhn, 1922 – 1996
Es war einmal ein junger und gelehrter Physiker, namens Thomas S. Kuhn. Er lebte in Amerika und wie er es schaffte als Trendsetter den Begriff Paradigma in alle gelehrten Munde zu befördern, ist eine schöne Geschichte für einen Winterabend:
Damals wurde wissenschaftliches Forschen mit folgender Legende beschrieben: Ein junger Forscher steht auf den Schultern von Giganten. Er beobachtet die Welt und baut auf dem auf, was Wissenschaftler vor ihm geschaffen haben. Und auf wessen Schultern man klettern sollte, steht in den Lehrbüchern.
Auch Kuhn sah dies so. Zumindest bis 1947. Dieser schrieb im Alter von 25 Jahren seine Dissertation in Physik. Wie Herr Häfner hatte auch er die Freude, Studienanfängern die Wissenschaftsgeschichte beizubringen. Dafür wollte er ein konkretes Beispiel raussuchen. Eine Fallstudie musste her und was eignete sich besser als von Aristoteles bis Newton das historisch angehäufte Wissen über Mechanik zu erklären.
Doch was er fand war keine Anhäufung von Wissen, im Gegenteil: Was Aristoteles damals dachte zu wissen klang schlicht idiotisch. Aristoteles konnte zwar viel über Mechanik reden, aber sie verstehen tat er offensichtlich nicht. Wie konnte ein so großer Denker so falsch liegen, fragte sich Kuhn. Des Rätsels Lösung war Kuhn selbst. Er hatte nicht berücksichtigt, dass für Aristoteles Begriffe wie „Bewegung“ und „Materie“ völlig andere Bedeutungen hatten. Sobald er sie zur Kenntnis nahm, erschloss sich ihm die Logik der antiken Weltsicht. Sie war nicht unwissenschaftlich. Nur anders.
Seitdem verabschiedete sich Kuhn von der Physik und wollte ausschließlich verstehen, wie sich Menschen die Welt erklären. Zunächst in Harvard und dann an der Universität von Kalifornien in Berkeley traf er die Philosophen seiner Zeit, wie Karl Popper. 15 Jahre später – im Jahre 1962 erschien sein Buch The structure of scientific revolutions, der Begriff des Paradigmas kam in Mode und die Legende des jungen Forschers auf dem Rücken der Giganten kam ins Wanken.
Kuhns Sicht der Dinge
„Die Entwicklung der Wissenschaft ist kein fortschreitendes Anwachsen des Wissensvorrates durch Akkumulation, sondern ein Prozess dezidierter Brüche“ (Kuhn, 1976, S. 91).
Kuhn prägte eine neue Sichtweise auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Statt, wie seine damaligen Kollegen anzunehmen, dass es sich bei der Wissenschaft um einen linear fortlaufenden Prozess handelt, bei dem der einzelne Forscher immer nach der nächst höheren Erkenntnis strebt und auf dem aufbaut, was andere vor ihm entwickelt haben, verläuft er für Kuhn in Phasen. Seiner Annahme folgend stellt wissenschaftlicher Fortschritt immer einen Bruch mit dem bisher Dagewesenen dar. Für ihn verläuft der Übergang nicht reibungslos, sondern in Revolutionen, die das alte gegen ein neues Paradigma eintauschen. Ein Paradigma ist laut Kuhn, wie eine Landkarte aufzufassen, ohne die der Forscher orientierungslos vor dem Chaos der Natur stünde. Diese Landkarte stellt den Bezugsrahmen dar, innerhalb dessen ein Forscher arbeitet, sie stellt die Methoden, Begriffe, Fragestellungen und gibt Richtlinien an die Hand für das Füllen der noch leeren Flecken der Landkarte.
Kuhns Theorie des wissenschaftlichen Fortschritts
Kuhn geht von einem allgemeinen Schema aus, wie sich wissenschaftlicher Fortschritt entwickelt. Im Nachfolgenden werden alle relevanten Phasen beschrieben.

Normalwissenschaft
„Ziel ist die Lösung eines Rätsels, für dessen bloße Existenz die Gültigkeit des Paradigmas vorausgesetzt werden muss“ (Kuhn, 1976, S.122).
In dieser Phase ist das Forschungsgebiet streng definiert. Die Grundannahmen des Paradigmas werden nicht in Frage gestellt und die Forscher vertiefen das Gebiet in dem sie, wie bei einem Puzzle, die inhärenten Fragestellungen mit den Methoden des Paradigmas lösen.
Anomalie / Krise
Tauchen Anomalien, also „Gegenbeispiele“ zum aktuell geltenden Paradigma auf, heißt das noch lange nicht, dass Forscher ihr Paradigma anzweifeln. Wissenschaftler sind sehr gut darin, diese Gegenbeispiele zu ignorieren, lächerlich zu machen, als Messfehler oder Zufall darzustellen oder die Theorie ein wenig anzupassen. Wenn jedoch entscheidende Grundlagen des Paradigmas betroffen sind, eine große Anzahl an Anomalien auftritt, es immer mehr Forderungen aus der gesellschaftlichen Praxis gibt und ein neues Paradigma aufgetaucht ist, dann kann es zur Krise des aktuellen Paradigmas kommen.
Außerordentliche Wissenschaft
Mit der Krise beginnt die Zeit des außerordentlichen Wissenschaftsbetriebs. Die Regeln des Paradigmas sind gelockert. Obwohl es noch ein Paradigma gibt, zeigen nur noch wenige Forscher eine völlige Übereinstimmung mehr darüber, worin dieses besteht. Die Forscher blicken über den Tellerrand ihrer bisherigen Weltsicht. In dieser Zeit werden laut Kuhn wirkliche wissenschaftliche Fortschritte erreicht.
Paradigmenwechsel
“Wissenschaftliche Revolutionen sind eine Verschiebung des Begriffsnetzes, durch welches die Wissenschaftler die Welt betrachten.” (Kuhn, 1976, S. 115).
Indem eine angenommene Wahrheit eines vorherrschenden Paradigmas wissenschaftlich widerlegt wird und ein neues Phänomen als Erklärungsmodell herangezogen wird, muss sich der Wissenschaftsbetrieb neu orientieren. Diese periodisch auftretenden Revolutionen in der Wissenschaft erzwingen das Ablegen vorheriger Normen und Werte. Eine Neudefinition der Wissenschaft erfolgt und neue Begriffe, Weisheiten und Lösungsansätze müssen her. Laut Kuhn waren die wichtigsten wissenschaftlichen Revolutionen die Kopernikanische, die Newton’sche, die chemische und die Einstein’sche Revolution. Zu beachten ist, dass sich Kuhn als Physiker auf die Analyse der Naturwissenschaft konzentrierte, in der differenzierter lineare Brüche in Form von Paradigmenwechseln beobachtet werden können. Natürlich treten Paradigmenwechsel auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf, doch diese erfolgen nicht immer linear. Hat sich das neue Paradigma etabliert, wird der Betrieb der Normalwissenschaft wieder aufgenommen und gemäß der neuen „Paradigmen-Brille“ geforscht.
Inkommensurabilität
Mit dem schönen Begriff der Inkommensurabilität beschreibt Kuhn nicht miteinander kompatible, unvereinbare Paradigmen. Man kann nicht gleichzeitig davon ausgehen, dass die Erde eine Scheibe und eine Kugel ist. Man denkt und forscht folglich entweder innerhalb des einen oder des anderen Paradigmas.
Kuhns Sicht auf die Wissenschaft
„Sie sehen nur, was sie sehen wollen“ (Kuhn, 1976, S.124).
Für Kuhn können wahre neue Entdeckungen nur gemacht werden, in Zeiten der „Unruhe“, in denen die Forscher ihre „Paradigmenbrille“ abgelegt haben. Nur so kann Wissenschaft dafür sorgen, dass nicht nur Landkarten gefüllt werden, sondern auch immer wieder neue Landkarten entstehen, mit neuen Theorien, Richtlinien und Normen.
Kuhn lehnt die Praxis der Normalwissenschaft jedoch auf keinen Fall ab. Denn ohne ein bestehendes Paradigma müsste jeder einzelne Forscher immer wieder bei Null anfangen. Paradigmen stellen so ein Gerüst dar, an dem sich die Forscher orientieren können. In der Normalwissenschaft testen Forscher, die einzelnen inhärenten Bausteine dieses Paradigmas und vertiefen somit das Wissen. Kuhn sagt: „Solange die von einem Paradigma gelieferten Hilfsmittel sich als fähig erweisen, die von ihm definierten Probleme zu lösen, schreitet die Wissenschaft dann am schnellsten voran und dringt am tiefsten ein, wenn diese Hilfsmittel voller Überzeugung gebraucht werden“ (Kuhn, 1976, S.136). Er vergleicht diesen Effizienzgedanken mit der Industrie, in der ein Austausch aller Maschinen auch eine Extravaganz und keine Regel darstellt. Jedoch kritisiert Kuhn die Betriebsblindheit der Wissenschaftler in der Normalwissenschaft, die nicht erkennen, wie abhängig sie von den Grundsätzen des jeweiligen Paradigmas sind. Wissenschaftler sind laut ihm unbemerkt eingeschränkt von ihren bestehenden Denkmustern. Die Denkmuster von heute könnten aber in 50 Jahren schon wieder überholt sein – ein neues Paradigma hat das jetzige abgelöst und alles was wir zu wissen glauben ist anders. Aus diesem Grund plädiert Kuhn für mehr Bescheidenheit in der Wissenschaft. Forscher sollen wahrnehmen, dass sie die Welt immer nur mit Hilfe einer bestimmten „Paradigma-Brille“ betrachten. Wissenschaft ist demnach genauso fehlbar, wie jeder einzelne Forscher. Sie wird auch „nur“ von Menschen gemacht und er nimmt dem Gebiet so den Hang zur Selbstverherrlichung.
Resümee der drei Medientheoretiker Popper, Feyerabend und Kuhn
Während Popper präskriptiv das richtige, deduktive Forschen vorgibt, appelliert Feyerabend durch eine induktive Herangehensweise den Methodenzwang abzulegen und regt zu einer interdisziplinären Forschung an. Kuhn schafft eine diplomatische Synthese beider und macht eine neue Achse im Koordinatensystem der Wissenschaft auf. Der Erfolg von Wissenschaft darf nicht mehr nur im kumulativen Anhäufen von Wissen gesehen werden, hier betitelt als Fortschritt, sondern auch in seiner Tiefe gemessen werden. Laut Kuhn bereichern periodisch auftretende wissenschaftliche Revolutionen die Wissenschaft, weil sie Forscher zwingen über den eigenen Tellerrand hinauszugucken und die in den Lehrbüchern postulierte Wahrheit zu hinterfragen und folglich mehr in die Tiefe zu gehen. Diese kreativen Sprünge in der Wissenschaft lassen sich unter dem Begriff der Abduktion fassen. Betrachtet man die heutige Popularität der drei Medientheoretiker, hat Poppers am meisten rezitierter, deduktiver Ansatz eine hohe Relevanz in der Naturwissenschaft, was sich im heutigen Forschen mit der Nullhypothese widerspiegelt. Kuhn beleuchtet dabei auch soziale und psychologische Faktoren, die den wissenschaftlichen Fortschritt hemmen können und stellt somit die Selbstherrlichkeit der Wissenschaft in Frage.

Praxisbezug und die Brücke zur GWK
Kuhns Sichtweise auf die Wissenschaft ist von einer psychologischen Perspektive sehr aktuell und relevant. Eine Vielzahl an empirischen Studien belegen die von Kuhn genannte Fehlbarkeit der Forscher: Das Phänomen der Sozialen Bewährtheit zwingt Forscher durch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck in von der Allgemeinheit anerkannten Gebieten zu forschen. Neue revolutionäre Thesen, Gedanken und Weltbilder müssen sich erstmal gegen eine Mauer von Kritik bewähren bis sie sozial anerkannt werden.
Als aktuelles Beispiel für die bis heute andauernde Relevanz von Kuhns Gedanken dient die revolutionäre Entdeckung der Neurogenese. Noch bis Mitte der 80er Jahre war einer der Grundsätze der Neurobiologie, dass wenn die Nervenzellen im Gehirn einmal ausgebildet sind, sich keine Neuen bilden können. So schrieb der Nobelpreisträger und Neuroanatom Ramón y Cajal 1913: „Im erwachsenen Gehirn sind die Nervenbahnen starr. Alles kann sterben, nichts kann sich erneuern“ (Schlütter, 2012). Dass das Gehirn sich verjüngen kann und neue Nervenzellen bilden kann, also Neurogenese betreiben kann, war ein revolutionärer Gedanke. Er stellt eine wichtige Grundannahme der Neurobiologie in Frage. Als der Biologe Fernando Nottebohm Neurogenese aber 1983 bewies, hagelte es das folgende Jahrzehnt Spott, Zweifel und Kritik unter anderem vom einflussreichen Neurobiologen Pasko Rakic von der Yale Universität. Es dauerte seine Zeit bis das Forschungsgebiet der Neurobiologie die Krise verarbeitete und den Paradigmen-Wechsel vollzog, um wieder in den Betrieb der Normalwissenschaft zurückzukehren und die neue revolutionäre Entdeckung der Neurogenese für die Forschung über Heilmethoden für Schlaganfall Patienten zu nutzen.
Kuhns Theorie über periodische Revolutionen in der Wissenschaft mag zwar für die GWK auf den ersten Blick von weniger Relevanz sein, aber die Lehre daraus, dass wir alle die Welt durch eine „Paradigmen-Brille“ sehen, gibt Anlass dazu, diese jeden Tag zu hinterfragen. Wie voreingenommen bin ich in meiner Forschung? Welchen Grundannahmen folge ich blind, ohne diese zu hinterfragen? So sagte auch Nottebohm der Entdecker der Neurogenese: „Was man zu wissen glaubt, kann einem die Sicht verstellen“ (Schlütter, 2012). Und sollte man durch seine kritisch reflexive Herangehensweise beim Forschen die Wissenschaft revolutionieren ist das ein Grund zur Freude. Ganz nach dem Motto: „Shift happens!“ (Wechsel passiert).
Quellen
Literaturverzeichnis
Kuhn, T. S. (1976). Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Ladyman, J. (2002). Understanding Philosophy of Science. London: Routledge Verlag.
Internetquellen
Schlütter, J. (2012, 29. September). Tagesspiegel: Revolutionen in der Wissenschaft. Wenn Weltbilder ins Wanken geraten. Zugriff am 17. November 2017 von http://www.tagesspiegel.de/wissen/revolutionen-in-der-wissenschaft-wenn-weltbilder-ins-wanken-geraten/7195358.html
Beisbart, C. (2008). Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie (Überblick 20. Jahrhundert) Thomas Kuhn über wissenschaftliche Revolutionen. Technische Universität Dortmund. Zugriff am 17. November 2017 von http://www.fk14.tu-dortmund.de/medien/ifpp/Philosophie/Beisbart/teaching/su2008/ps/a11.pdf
Das Wissenschaftscomic – die erste Ausgabe Der Paradigmenwechsel
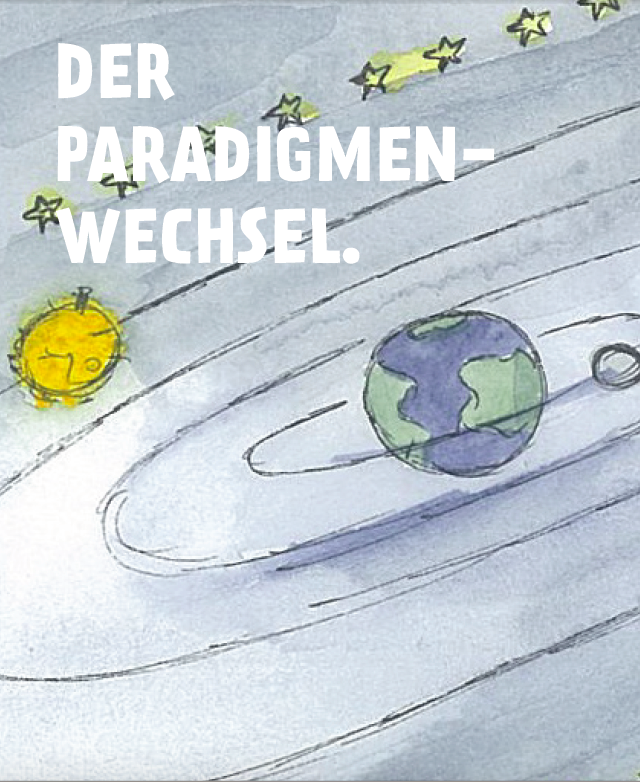



Formal: 3 Punkte
Zitation – einseitige Quellenangabe oder -nutzung, da nur Kuhn selbst genannt
Rechtschreibung – im Absatz unter „Kuhns Sicht der Dinge“ mehrere Groß-/Kleinschreibfehler hintereinander; im Resümee-Teil wird ‚Abduktion‘ falsch geschrieben
Inhaltlich: 4
Sehr anschaulich und verständlich aufgebaut. Theoretische Fakten gut im Narrativ verpackt.
Einordnung des Themas: 3
Geringer Bezug auf die GWK/Praxis oder auf aktuelle Wissenschaftsdiskurse.
Guter Zusammenhang zu den Theoretikern Popper und Feyerabend gegeben.
Zusammenfassender Kommentar: Der Kuhnsche Blogeintrag stellt eine sehr gute Mischung aus informativem und narrativem Content sowie einigen Visualisierungen dar und liest sich daher flüssig. Der Beitrag schafft es historisch weit zurückliegende theoretische Erkenntnisse sehr nah an einen zu bringen. Es fehlt jedoch noch die Brücke zur GWK und zur praktischen Anwendbarkeit.
LikeLike
Review zum ersten Gutachten:
Das erste Gutachten bewertet den Beitrag mit drei Punkten in der Formalität und ergründet weitgehende grammatikalische als auch Zitationsdefizite. Eine einseitige Quellenangabe ist nicht sehr repräsentativ und muss immer kritisch betrachtet werden.
Rechtschreibung wird sogar gezielt kritisiert. Rechtschreibung als solches ist in Form eines Blogbeitrages für Profis auf dem Gebiet natürlich schwierig zu umgehen. Inhaltlich orientierte Leser mögen darüber hinweg sehen. Die Bewertung mit 3 Punkten ist für mich durch die angebrachte Kritik durch Gutachter 1 nicht nachvollziehbar, denn diese Mängel können keine 3 Punkte erhalten. Inhaltlich äußert sich Gutachter 1 sehr positiv und vergibt volle Punktzahl in diesem Review-Verfahren. Die Einordnung in den thematischen Kontext des Studiengangs ist allein mit dem historischen Zwang des Themas sehr schwer zu bewerkstelligen. Inhaltliche Aufgabe war es, den Zusammenhang wissenschaftstheoretischer Grundlagen zwischen KUHN, FEYERABEND und POPPER zu geben. Die Aufgabe bestand nicht zwingend darin, die Themen in den Kontext der GWK zu heben.
Gutachter 1 erhält:
formal 2 Punkte,
inhaltlich 3 Punkte und
für die Relevanz 2 Punkte.
LikeLike
Review des ersten, anonymen, Gutachtes/ Zug 1:
Das erste Gutachten bewertet den Beitrag mit drei Punkten in der Formalität und ergründet weitgehende grammatikalische als auch Zitationsdefizite. Eine einseitige Quellenangabe ist nicht sehr repräsentativ und muss immer kritisch betrachtet werden.
Rechtschreibung wird sogar gezielt kritisiert. Rechtschreibung als solches ist in Form eines Blogbeitrages für Profis auf dem Gebiet natürlich schwierig zu umgehen. Ausschließlich inhaltlich orientierte Leser mögen darüber hinweg sehen. Die Bewertung mit 3 Punkten ist für mich durch die angebrachte Kritik durch Gutachter 1 nicht nachvollziehbar, denn diese Mängel können keine 3 Punkte erhalten. Inhaltlich äußert sich Gutachter 1 sehr positiv und vergibt volle Punktzahl in diesem Review-Verfahren. Die Einordnung in den thematischen Kontext des Studiengangs ist allein mit dem historischen Zwang des Themas sehr schwer zu bewerkstelligen. Inhaltliche Aufgabe war es, den Zusammenhang wissenschaftstheoretischer Grundlagen zwischen KUHN, FEYERABEND und POPPER zu geben. Die Aufgabe bestand nicht zwingend darin, die Themen in den Kontext der GWK zu heben.
Gutachter 1 erhält:
formal 2 Punkte,
inhaltlich 3 Punkte und
für die Relevanz 2 Punkte.
LikeLike
2. Gutachten von Bonnie & Steph
Formal: 4 Punkte – Dass die Autorinnen sich im ersten Teil nur auf Kuhn als Quelle bezogen haben, ist angemessen, da es vor allem um eine Auseinandersetzung mit dem Denken Kuhns ging. Die Kommentare der ersten Gutachten wurden dennoch sehr überzeugend verarbeitet, wodurch sich daran nichts weiter auszusetzen lässt.
Inhaltlich: 4 Punkte – Zentrale Begriffe wurden einschlägig erklärt und vor allem sehr anschaulich in (wirklich tollen) Illustrationen bzw. in einem Schaubild zugänglich gemacht. Die Argumentation ist schlüssig und auch für müde Leser*innen leicht zu verfolgen. Eine ausführliche Auseinandersetzung und eine tiefe Kenntnis der Materie lassen sich eindeutig vernehmen.
Einordnung des Themas: 4 Punkte – Schon im ersten Manuskript wurde ein relevanter Bezug zu den vorherigen Vorträgen hergestellt, dies wird zudem um einen prägnanten GWK-Bezug ergänzt.
Es gibt nichts weiter auszusetzen. Wir sind sehr beeindruckt von der vielschichtigen Auseinandersetzung mit Kuhn’s Wissenschaftsphilosophie, die nicht nur leicht verdaulich, sondern auch mit großem illustrativen Aufwand präsentiert wurden.
LikeLike
Review vom 2. Gutachten von Gina:
Ich stimme dem 2. Gutachten voll und ganz zu und sehe daher von jeglicher Kritik ab.
Gutachterinnen 2 Steph & Bronwen erhalten:
formal, inhaltlich, sowie für die Relevanz: VIER PUNKTE.
LikeLike